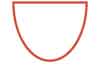Sie fragen – Wir antworten
Sie fragen – Wir antworten
Häufig gestellte Fragen an uns
Wer ist die Initiative kunsthilftheilen?
Kunsthilftheilen wurde von uns – Nici Schulcz Pereira und Nelson Ramos Pereira– 2021 gegründet. Als Kernteam kümmern wir uns um organisatorische, finanzielle und praktische Dinge. Projekte von kunsthilftheilen sollen mit Kooperationspartner:innen stattfinden.
Dazu laden wir uns Kollaborateur:innen mit unterschiedlicher inhaltlicher Expertise ein. Personen, die Erfahrung mit psychischen Erkrankungen haben sowie weitere Personen mit Erfahrung in Künsten und/oder künstlerischen Therapien. Fast alle Kliniken bieten Betroffenen neben einer Behandlung mit Medikamenten, Psychotherapien und künstlerische Therapien an. Wir möchten hier das Feld der ambulanten künstlerischen Therapien und künstlerischen Begleitung in Kooperation mit den Zuweisern und Kostenträgern ganz neu denken und aufbauen. Nici ist die Ansprechpartnerin für Kunst, schmuckhaftes Gestalten und den Malort und Nelson ist Ansprechpartner für ambulante Kunsttherapie, Lehrtherapie und Mentorat. Unsere Projekte befassen sich mit dem Atelier im Badhaus in Unterwindisch und mit Verkaufsausstellungen (Kettenkitsch) in der alten WISA GLORIA Haus A an der Sägestrasse 44, 1. Stock in Lenzburg/AG. Weitere Projekte folgen.
Was sind künstlerische Therapien?
Künstlerischen Therapien sind Therapieformen, die mit unterschiedlichen künstlerischen Medien arbeiten. Zu den Künstlerische Therapien werden Kunsttherapie, Musiktherapie, Tanztherapie, Theatertherapie und Sprachtherapie u.a. gezählt. Künstlerische Therapien werden in Kliniken, privaten Praxen und Ateliers oder auch in Schulen angewandt. Sie können bei verschiedenen Menschen mit ganz unterschiedlichen Themen und Problemstellungen sinnvoll sein. Im Vergleich zu Gesprächstherapien arbeiten sie neben Sprache auch mit künstlerischen Mitteln. Es geht darum, Gedanken, Gefühle und Erfahrungen spielerisch auszudrücken – durch malen, zeichnen, plastizieren, fotografieren, singen, musizieren oder tanzen. So kann ich einen neuen Ausdruck für ein persönliches Thema finden, das mich aktuell beschäftigt, ohne, dass ich das Thema unbedingt in Worten benennen oder einer anderen Person erklären muss. Das ist dann besonders hilfreich, wenn es schwer fällt über die eigenen Erlebnisse zu sprechen oder geeignete Worte dafür zu finden. Anders als ein Gespräch, ermöglicht die Übersetzung meiner Erlebnisse in künstlerische Prozesse und Produkte ein Nacherleben meiner Erfahrungen durch Aussenstehende. Der künstlerische Ausdruck meiner Erfahrungen kann mir neue Perspektiven ermöglichen, mir helfen, meine Erfahrungen zu kommunizieren und mich persönlich weiterzuentwickeln. In künstlerisch-therapeutischen Prozessen steht also der persönliche Ausdruck im Vordergrund. Es geht nicht darum, ein besonders “schönes Bild” zu malen oder eine besonders “tolle Choreographie” zu entwickeln. Dennoch kann mit dem künstlerischen Werk, das entsteht, weiter gearbeitet werden. Es kann mitgenommen, präsentiert, besprochen, ausgestellt oder aufgeführt werden.
Was macht ihr in euren Projekten: Kunst oder künstlerische Therapie?
Wir haben uns beidem gleichermassen verschrieben und schätzen Postdisziplinarität. Das bedeutet es geht uns beiden um den Gegenstand, nicht darum, wer aus welcher Disziplin kommt. Für uns gibt es daher kein Entweder-Oder. Kunst und Künstlerische Therapien gehen in unserer Arbeit fliessend ineinander über und sind nicht so einfach voneinander zu trennen. In unserer Arbeitsauffassung sind künstlerische und psychische Prozesse miteinander verknüpft. Ein ästhetischer Blick ist uns ebenso wichtig, wie innere und soziale Prozesse. Manchmal kann es ein Kunstwerk geben, das später gezeigt wird. Es geht auch nicht ausschliesslich um eine finale Ausstellung. Der Schaffensprozess ist uns ebenso wichtig. Die Künstlerischen Therapien ergänzen dabei die Künste, indem sie psychische und soziale Prozesse gezielt mit einschliessen. Während Kunst keinem äusseren Zweck genügen muss (L’art pour l’art), verfolgen Künstlerische Therapien ein L’art pour l’autre, also eine “Kunst füreinander”. Wir stehen für eine Demokratisierung von Künsten, d. h. wir wollen Künste allen zugänglich machen. Vorerfahrung oder sogenannte Begabung sind nicht erforderlich um an künstlerischen Therapien teilzuhaben. Ich muss also nicht notwendigerweise Tanz, Theater, Musik oder Bildende Kunst studiert haben, um mich künstlerisch auszudrücken. Nun ist es so dass bei kunsthilfheilen Nici sich mehr der Kunst und um eine nie zuvor angewandte Betrachtungsweise der Spur (die jegliche Deutung ausschliesst) verpflichtet fühlt und Nelson seinen Arbeitsschwerpunkt in der Kunsttherapie findet.
Was macht die Kunst in der Kunsttherapie?
Kunst lässt verschiedene Sichtweisen zu und eröffnet ganz neue. Kunsttherapie ist eine Arbeitsweise, die sich im Medium der Bildenden Kunst bewegt. Gedanken, Gefühle, Schwierigkeiten und Situationen finden im bildnerischen Schaffen Ausdruck. So können sie sich ihren Gedanken, Emotionen und Herausforderungen auf konstruktive Weise nähern. In der Kunsttherapie kommen sie im spielerischen Umgang mit dem eigenen Inneren in Kontakt. Kunst machen bietet Anregung zu neuen, kreativen und lösungsorientierten Denk- und Handlungsweisen und fördert ihre Persönlichkeitsentwicklung.
Unsere Arbeitsweise ist prozessorientiert und geht auf ihre individuellen Bedürfnisse und ihren gestalterischen Verlauf ein. Dabei steht nicht das Ergebnis, sondern das Erschaffen an sich im Mittelpunkt. Eine feste Zielvorgabe, wie das Kunstwerk auszusehen hat, gibt es nicht. Es geht nicht vorrangig darum, „gut malen zu können“ oder künstlerische Techniken zu erlernen, sondern darum, einen authentischen individuellen Ausdruck zu finden und weiter zu entwickeln. Der Gedanke, etwas „falsch“ beziehungsweise „nicht gut“ zu machen hindert uns häufig daran, eigene Ideen umzusetzen. Im wertfreien Rahmen prozessorientierter Arbeit können sie neue, kreative Erfahrungen machen. Dabei kann es auch sein, das wir schlicht nach einem neuen Interesse im Gewöhnlichen und im Alltäglichen suchen.
Die dabei verwendeten bildnerischen Materialien sind so vielfältig wie die Menschen selbst. Sie reichen von klassischen Medien wie Zeichnung und Malerei über Collage, Plastik, Fotografie, Textil, darstellend-performativen Formen bis hin zu zeitgenössischen Formaten wie Installation und Aktionskunst.
Was bedeutet ästhetisches Handeln?
Ästhetisches Handeln leitet sich von zwei Quellen ab: von Beuys‘ Sozialer Plastik und von Michel Foucault mit seiner Bemerkung: „… die Ausbildung und die Entwicklung einer Praxis des Selbst, die zum Ziel hat, sich selbst als Arbeiter an der Schönheit seines eigenen Lebens herauszubilden.“
Wir wollen Kunst leben. Wir sprechen von Asketik im Sinne des griechischen Wortes áskesis: Übung. Wir experimentieren also im Sinne von Foucault und führen ästhetisch-gestaltende Übungen durch. Wie beispielsweise sogenannten Urgebärden, sowie verschiedene Übungen zu Handformen und den Basis-Sinnen. Erkenntnis allein reicht nicht, darum laden wir dazu ein, selber zu üben.
Was bedeutet sensomotorische Kunsttherapie?
Langsamkeit und Intensität sind zwei wichtige Prinzipien in der sensomotorischen Kunsttherapie. Sie setzt am Gestaltbildungsprozess an, noch bevor eine Gestaltung entsteht. Im Fokus steht das Verknüpfen von Bewegung und sensorischer Wahrnehmung mit deren Rückmeldungen im Körper. Durch die Kopplung positiver Beziehungserfahrungen mit gleichzeitiger Wahrnehmung des Körpers können Affektregulierung und Selbstwert positiv beeinflusst werden. Wird dieser Prozess differenziert begleitet, können erlernte Handlungs- und Beziehungsmuster erkannt und verändert werden.
Dazu gehören Übungen, wie die Methoden Formenzeichnen, das Geführte Zeichnen, die Arbeit am Tonfeld® sowie Impulse aus dem Lösungsorientierten Malen LOM®. Deren gemeinsame Grundlagen, Mittel, Medien und das Gestalten sind am Prinzip „Low Skills, High Sensitivity“ orientiert.
Wann sind künstlerische Therapien nicht geeignet?
Künstlerische Therapien helfen nicht gegen nachgewiesene organisch bedingte Erkrankungen wie beispielsweise Tumorerkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungenoder Stoffwechselstörungen. In diesem Fall ist es unerlässlich, sich für die Behandlung an ärztliches Fachpersonal zu wenden, um eine eventuell medikamentöse oder chirurgische Behandlung einzuleiten. Natürlich können Künstlerische Therapien als ergänzende Fachtherapien helfen, Erkrankungen und mögliche Folgeerscheinungen zu akzeptieren.
Auch bei psychischen Störungen wie Psychosen, Schizophrenien und bei manischen Erkrankungen bietet künstlerische Therapien alleine keine ausreichende Behandlungsgrundlage. Auch hier ist es unerlässlich, sich an eine Fachärzt:innen für Psychiatrie und Psychotherapie zu wenden. Eine frühzeitige stationäre oder medikamentöse Behandlung der Symptome ist häufig notwendig, um eine Chronifizierung zu vermeiden und eine Selbst- oder Fremdgefährdung abzuwenden.
Jedoch helfen ambulante künstlerische Therapien als ergänzende Fachtherapien bei der Krankheitsbewältigung. In jedem Fall, insbesondere auch zum Ausschluss eventueller organischer Ursachen, raten wir grundsätzlich zu einer ersten diagnostischen Abklärung bei ihren Haus- oder Fachärzten. Gestaltung im therapeutischen Prozess kann erschüttern: Bei kunsthilftheilen finden sie dafür die notwendige sorgsame und professionelle kunsttherapeutische Begleitung.
Was heisst prozessorientiertes Gestalten?
Künstlerische und innere Prozesse sind nicht plan- oder vorhersehbar. Daher ist unsere Arbeitsweise prozessorientiert. Sie geht flexibel auf alles ein, was im Prozess entsteht. Wir können zwar auf eine Ausstellung hin arbeiten; Dabei steht aber nicht das “Produkt” Ausstellung, sondern das Erschaffen an sich im Mittelpunkt. Konkret heisst das, dass wir keine feste Zielvorgabe haben, wie diese Ausstellung auszusehen hat, sondern diese mit allen Kollaborateur:innen gemeinsam und gleichberechtigt entwickeln.
Was heisst partizipative Arbeit?
Partizipation bedeutet Mitbestimmung. Wir arbeiten partizipativ, d. h. alle Kollaborateur:innen haben ein gleichwertiges Mitspracherecht. Wir versuchen Hierarchien, Rangordnungen oder Machtgefälle zwischen den Beteiligten zu vermeiden. Die Meinung und Erfahrung einer:eines Betroffenen zählt genauso viel, wie die Meinung oder Erfahrung eines:einer Künstler:in oder Künstlerischen Therapeut:in. Als Kernteam von kunsthilftheilen kümmern wir uns um das Organisatorische. In der künstlerischen Arbeit und bei Ausstellungen gibt es keine Vorgaben. Wir wollen dem Raum geben, was sich zwischen Kollaborateur:innen und in den künstlerischen Medien entwickelt. Wie schon erwähnt, wollen wir Künste allen zugänglich machen. Vorerfahrung oder sogenannte Begabung sind nicht erforderlich um an den Projekten von kunsthilftheilen mitzugestalten.
Wie melde ich mich für den Malort, Kunsttherapie oder Lehrtherapie an?
Sie können direkt online ihren Termin buchen, telefonisch, über unser Kontaktformular oder direkt per E-Mail anmelden.
Was ist, wenn ich einen Termin verschieben oder absagen muss?
Bis 48 Stunden vorher ist ihre Absage im Verhinderungsfall kostenfrei möglich. Bei kurzfristigen Absagen bemühen wir uns, die freie Zeit anderen Klienten anzubieten. Gelingt dies nicht, verrechnen wir eine Pauschale von 90 sFr (muss privat bezahlt werden). Bei Nichterscheinen ohne Abmeldung wird der volle Tarif privat verrechnet.
Übernimmt die Krankenkasse die Therapiekosten?
Viele Krankenkassen bzw. Versicherungen (Kostenträger) leisten Beiträge an nichtärztlicher Kunsttherapie. Fragen Sie bei Ihrer Kostenträgerin über deren Beitrag an Kunsttherapie nach und informieren Sie sich über die OdA ARTECURA. Meist ist eine Zuweisung mit Verordnungsformular durch eine Ärztin oder einen Arzt erforderlich. Nutzen Sie dafür folgendes Formular. Falls Sie unsicher sind, ob Ihre Kostenträgerin einen Teil der Behandlungskosten erstattet, empfehlen wir Ihnen, direkt mit Ihr Kontakt aufzunehmen. Bitte klären Sie im Voraus, ob die gewählte Behandlungsmethode abgedeckt ist. Jede Kostenträgerin erstattet nur Behandlungen gemäss ihres Leistungskatalogs. Die Rechnungsstellung mit einem Rückerstattungsbeleg erfolgt am Monatsende, sodass Sie die Erstattung bei Ihrer Kostenträgerin beantragen können. Nelson ist bei den Zusatzversicherungen unter folgenden Nummern hinterlegt: ZSR-Nr. I226063, EMR-Nr. 41598, ASCA-ID 100792, EGK-Nr. 50813. Bei Rückfragen können Sie diese Nummern bei ihrer Kostenträgerin angeben.
Mit welchen Materialien wird im Atelier bei euch gearbeitet?
In unserem Atelier ist eine Vielfalt an Materialien und Farben vorhanden. Sie können mit hochwertige Öl- und Pastellkreiden, Aquarell-, Gouache-, Acrylfarben oder Kohle arbeiten. Foto- und Bildbearbeitung kann analog, wie digital zum Einsatz kommen. Es kann mit Tonerde, Kaschierpapier und vielen weiteren Materialien plastisch gearbeitet werden.
Ich kann nicht malen. Soll ich trotzdem kommen?
Sehr gern! Sie brauchen keinerlei Vorkenntnisse. Wir habe Erfahrung darin, Menschen an Kunst und Kunsttherapie heranzuführen. „Come as you are“ (Kurt Cobain)
Sprechen wir über meine Arbeiten und Werke?
Als Künstler und Kunsttherapeuten unterstützen wir Entstehungsprozess, Werk und Gestaltende individuell. Gerne nehmen wir uns die Zeit für ein Gespräch, wo nach Wunsch und Bedürfnis, über das Erlebte nachgedacht, Gedanken und Empfindungen mitgeteilt werden können.
Das Atelier von kunsthilfheilen im Badhaus soll ein Orte sein, wo Fantasie und Kreativität erlebt werden können. Nur dem eigenen Thema und Rhythmus verpflichtet schöpfen Sie aus dem breiten Spektrum kreativer Materialien und Techniken.
Quelle: https://www.kunsthochzwei.com/pop-up-institut/ Herzlichen Dank an Kerstin Schoch für die freundliche Genehmigung zur Anregung und Nutzung ihrer FAQs